-
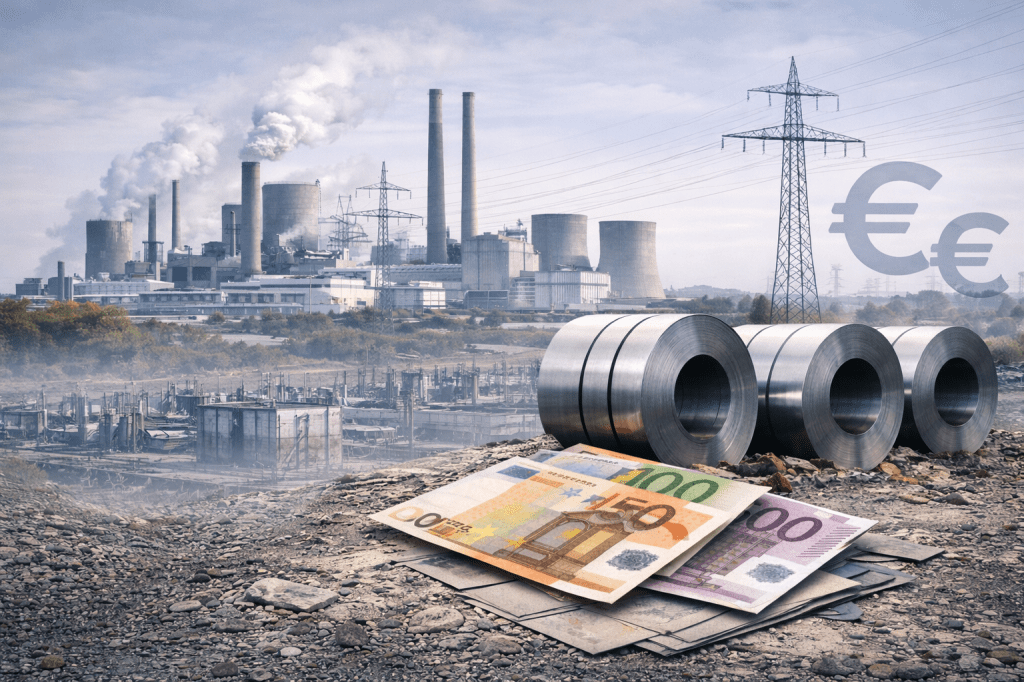
Geplanter Industriestrompreis – Überblick zum aktuellen Entwurf der Förderrichtlinie
Der aktuelle Entwurf zum Industriestrompreis sieht ab 2026 eine zeitlich befristete Strompreisentlastung für stromintensive Unternehmen vor. Die Förderung ist an Investitionen in Dekarbonisierung und Flexibilisierung gebunden und steht unter beihilfe- sowie haushaltsrechtlichem Vorbehalt.
-

Keine Verjährung von Ansprüchen auf Ausschüttung der Bilanzierungsumlage zum 31.12.2025
Die Frage, wann Ansprüche auf Beteiligung an der Ausschüttung der Bilanzierungsumlage verjähren, scheint diskussionswürdig. Wir sind überzeugt, dass hier am Jahresende 2025 nichts droht.
-
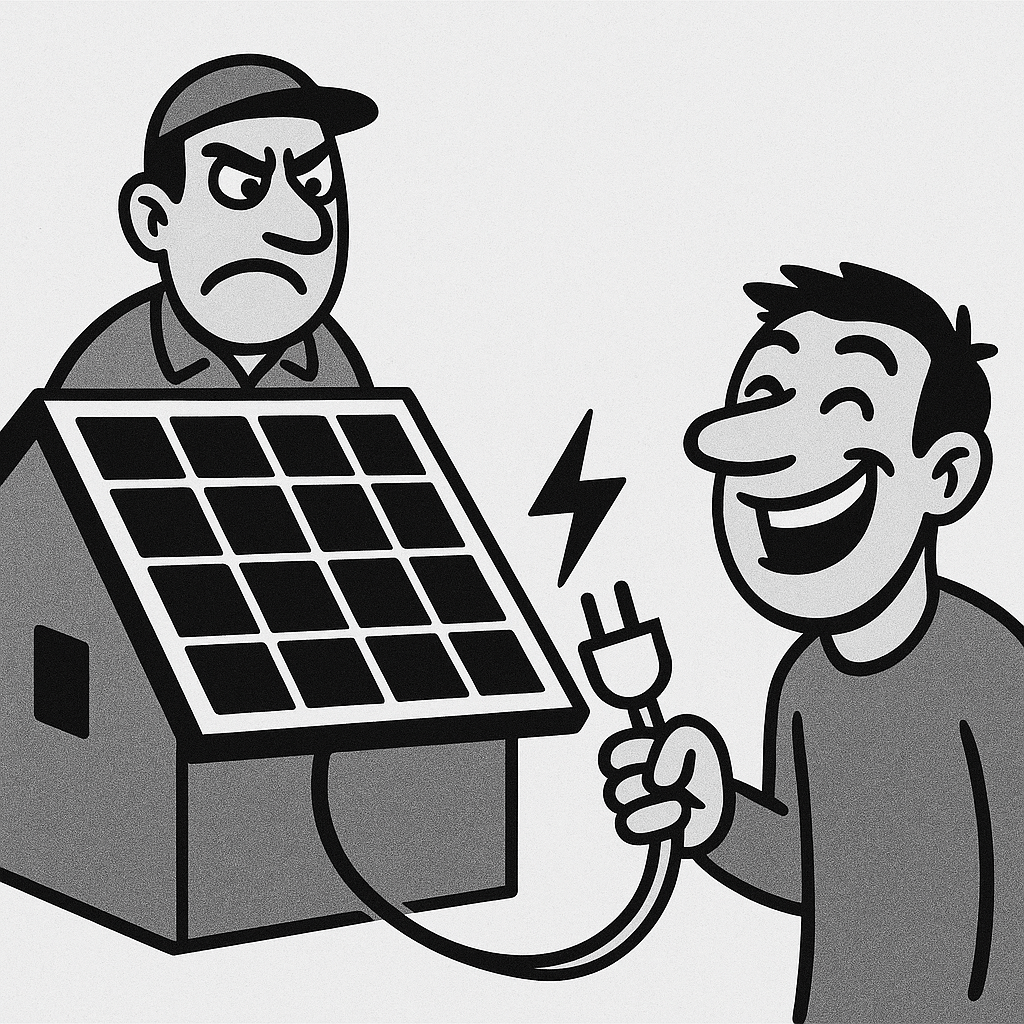
Die „unentgeltliche Abnahme“ von Strom aus EE-Anlagen – warum Netzbetreiber diese übersehen und unberechtigt Pönalen fordern?
Immer mehr Anlagenbetreiber lassen Pönalezahlungen von Netzbetreibern überprüfen, da diese häufig die Zuordnung zur „unentgeltlichen Abnahme“ übersehen. Ein Typusfall zeigt, wie Netzbetreiber oft Strafzahlungen abrechnen, obwohl neuere Regelungen im EEG die Zuordnung von Anlagen in die „unentgeltliche Abnahme“ schaffen und damit keine Strafzahlungen anfallen würden.
Neueste Beiträge:
- Geplanter Industriestrompreis – Überblick zum aktuellen Entwurf der Förderrichtlinie
- Keine Verjährung von Ansprüchen auf Ausschüttung der Bilanzierungsumlage zum 31.12.2025
- Die „unentgeltliche Abnahme“ von Strom aus EE-Anlagen – warum Netzbetreiber diese übersehen und unberechtigt Pönalen fordern?
- Kundenanlage: Bestandsschutz – und dann?
- Bundestag beschließt Strom- und Energie-steueränderungen
- Bundestag beschließt vss. (nur) Entfall der Gasspeicherumlage am 06.11.2025
Allgemein (123) Auswahl News nach Themen (6) Baurecht (3) Datenschutzrecht (13) Elektromobilität (16) Energiebegriffe (19) Energierecht (181) Immobilienrecht (2) Industrie (1) Netzentgelte (1) Schadensersatzrecht (2) smart meter (1) Steuerrecht (25) Stromspeicher (4) Vergaberecht (1) Webtalk und Seminare (3)
Befreiung bgh BNetzA Bundesnetzagentur Datenschutz DSGVO E-Auto E-Mobilität eeg EEG-Eigenstromprivileg EEG-Umlage EEG-Umlage Befreiung Eigenversorgung Elektromobilität Energiesteuer EU EU-Kommission Frist Förderung Gas Gaspreis Gaspreisbremse Grundversorgung Kanzlei Kommission kwk KWKG Ladeinfrastruktur Ladepunkt Messung Netzentgeltbefreiung Netzentgelte Preisanpassung Preisanpassungsklausel Preisbremse Reduktion Strom Strompreis Strompreisbremse Stromsteuer umlage Urteil Wärmepreisbremse § 19 Abs. 2 StromNEV Übergangsregelung